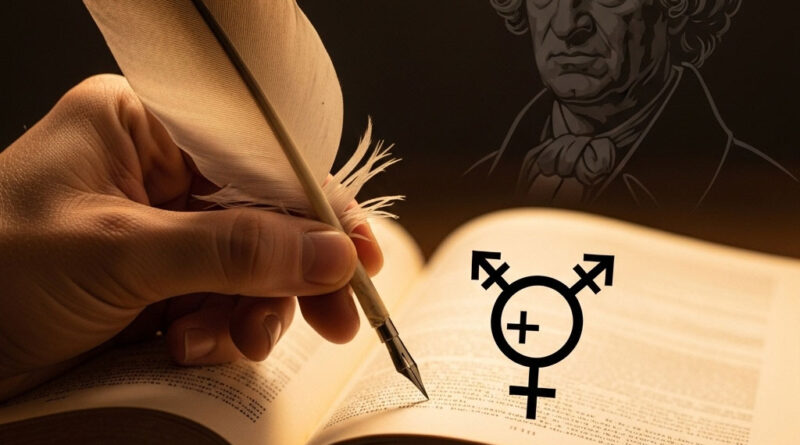Gendern damals und heute: Goethe, Lessing und andere Klassiker
Wenn heute über gendergerechte Sprache diskutiert wird, fällt oft das Argument, es handle sich um eine moderne Erfindung, ein Kind der politischen Korrektheit und identitätspolitischer Strömungen. Doch ein Blick in die deutsche Literaturgeschichte zeigt ein anderes Bild: Schon im 18. Jahrhundert experimentierten bedeutende Schriftsteller mit weiblichen Formen, kritisierten grammatische Ungereimtheiten und reflektierten über die Sichtbarkeit von Frauen in der Sprache.
Historischer Kontext: Sprachpflege und Sprachreform
Bereits im 17. Jahrhundert entstand mit der „Fruchtbringenden Gesellschaft“ eine erste deutsche Sprachakademie, deren Ziel es war, die deutsche Sprache zu pflegen und zu vereinheitlichen. Dabei ging es nicht nur um Rechtschreibung oder Grammatik, sondern auch um Wortwahl, Verständlichkeit und kulturelle Repräsentation. In dieser Zeit war die Frage, wie Frauen sprachlich erfasst werden, durchaus präsent – wenn auch oft beiläufig.
Im 18. Jahrhundert gewann diese Debatte neue Dynamik. Mit der Aufklärung entstanden bürgerliche Zeitschriften, in denen nicht nur Männer, sondern auch Frauen als Leserinnen und Autorinnen angesprochen wurden. Sprache wurde zum Werkzeug gesellschaftlicher Veränderung, und einige Autorinnen und Autoren begannen, weibliche Formen gezielt zu verwenden.
Gottsched und die „Vernünftigen Tadlerinnen“
Ein prominentes Beispiel liefert Johann Christoph Gottsched, einer der einflussreichsten Sprachtheoretiker seiner Zeit. Gemeinsam mit seiner Frau Luise Adelgunde Victorie Gottsched gab er 1725/26 die moralische Wochenschrift „Die vernünftigen Tadlerinnen“ heraus. Schon der Titel ist bemerkenswert: Die Wahl der weiblichen Pluralform „Tadlerinnen“ stellte klar, dass Frauen nicht nur passive Leserinnen, sondern handelnde, kritische Subjekte sein konnten.
Gottsched ging noch weiter. In seinen Texten finden sich konsequent Formen wie „Bekanntinnen“ und „Verwandtinnen“. Diese Wortbildungen, die heute teils ungewohnt klingen, machten Frauen sprachlich sichtbar. Damit setzte er ein bewusstes Signal – und das mehr als 250 Jahre vor der Einführung von Genderstern oder Binnen-I.
„Es ist die Pflicht eines vernünftigen Schriftstellers, allen Geschlechtern die Ehre zu geben, die ihnen gebühret.“ – Johann Christoph Gottsched
Lessing und die feminisierte Bühne
Gotthold Ephraim Lessing, ein Freund klarer Sprache und kritischer Vernunft, schloss sich diesem Ansatz teilweise an. In seiner „Hamburgischen Dramaturgie“ finden sich ebenfalls Formen wie „Bekanntinnen“. Er verwendete zudem feminisierte Nachnamen, wie etwa „Neuberin“ für die Schauspielerin und Theaterleiterin Friederike Caroline Neuber.
Diese Praxis war nicht nur sprachlich, sondern auch gesellschaftlich relevant: In einer Zeit, in der Frauen auf der Bühne und in der Öffentlichkeit um Anerkennung kämpfen mussten, verlieh Lessing ihnen sprachlich eine eigenständige Rolle. Das Gendern war hier kein Selbstzweck, sondern Ausdruck einer Haltung, die Frauen als gleichwertige Akteure in der Kunst betrachtete.
Goethes sprachkritischer Blick
Johann Wolfgang von Goethe, der wohl bekannteste Dichter deutscher Sprache, war zwar kein systematischer Verfechter weiblicher Sprachformen wie Gottsched, doch er äußerte sich kritisch zu bestimmten grammatischen Strukturen. Besonders störte ihn die Verwendung des Neutrums für weibliche Personen, wie im Wort „das Mädchen“ oder „das Fräulein“.
Goethe empfand diese Formen als unlogisch und entwürdigend, da sie das Geschlecht der Bezeichneten sprachlich verschleiern. In einem Brief soll er bemerkt haben, dass die deutsche Grammatik in dieser Hinsicht „gegen die Natur“ verstoße. Damit wies er auf ein Problem hin, das bis heute im Zentrum der Gendersprachdebatte steht: die Frage, ob Sprache Realität abbildet oder verzerrt.
„Das Mädchen bleibt ein Es, auch wenn es eine Sie ist.“ – zugeschrieben Goethe
Sprache als Spiegel der Gesellschaft
Die Beispiele aus der Klassik zeigen, dass Sprachbewusstsein kein Produkt des 21. Jahrhunderts ist. Schon damals gab es Bestrebungen, Frauen sprachlich sichtbarer zu machen oder grammatische Eigenheiten zu hinterfragen. Der Unterschied: Die damaligen Formen waren eingebettet in den Sprachgebrauch ihrer Zeit und erschienen den Lesern weit weniger als radikal.
Interessanterweise verschwanden viele dieser Formen später wieder. Begriffe wie „Bekanntinnen“ wurden im 19. Jahrhundert zunehmend vom generischen Maskulinum verdrängt, das in der bürgerlichen Kultur als neutral und universell verstanden wurde – auch wenn es faktisch männlich geprägt war.
Feministische Linguistik und der Bruch mit dem Generikum
In den 1980er-Jahren brachte die feministische Sprachwissenschaft das Thema mit neuer Vehemenz zurück. Linguistinnen wie Luise F. Pusch oder Senta Trömel-Plötz kritisierten, dass das generische Maskulinum Frauen systematisch unsichtbar mache. Sie forderten neue Formen wie das Binnen-I („LehrerInnen“) oder neutrale Partizipialformen („Studierende“).
Die Leitlinie war klar: Frauen und Männer – und später auch nicht-binäre Personen – sollten sprachlich gleichberechtigt repräsentiert werden. Damit knüpften die feministischen Linguistinnen indirekt an Traditionen der Klassik an, auch wenn die Formen sich geändert hatten.
„Sprache ist nicht unschuldig. Wer in ihr nicht vorkommt, kommt auch im Denken nicht vor.“ – Luise F. Pusch
Moderne Debatten und Konfliktlinien
Heute wird Gendern heftig diskutiert. Befürworterinnen und Befürworter sehen darin ein wichtiges Instrument für Gleichberechtigung und Sichtbarkeit. Gegnerinnen und Gegner halten es für sprachlich unästhetisch, kompliziert oder gar ideologisch motiviert. Institutionen wie die Gesellschaft für deutsche Sprache erkennen die berechtigte Absicht an, raten aber zur Maßhaltung und Verständlichkeit.
Ein zusätzlicher Konfliktpunkt ist die Umsetzung: Genderstern, Doppelpunkt, Unterstrich oder Paarformen – jede Variante hat Anhänger und Kritiker. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband weist etwa darauf hin, dass das Sternchen in Sprachausgaben schlecht wiedergegeben wird, während Paarformen in gesprochener Sprache einfacher zugänglich sind.
Parallelen zwischen damals und heute
Die historische Perspektive macht deutlich: Gendern ist nicht einfach ein Bruch mit der Sprachtradition, sondern steht in einer langen Reihe von Versuchen, Sprache an gesellschaftliche Realitäten anzupassen. Die Formen haben sich geändert, die Grundfrage ist gleich geblieben: Wie können wir Menschen so benennen, dass alle gemeint und gesehen werden?
Gottscheds „Bekanntinnen“ und „Verwandtinnen“, Lessings „Neuberin“ und Goethes Kritik am Neutrum – sie alle sind Vorläufer einer Diskussion, die heute wieder leidenschaftlich geführt wird. Sie zeigen, dass sprachliche Inklusion kein neues Anliegen ist, sondern tief in der deutschen Literaturgeschichte verwurzelt.
Von der Klassik lernen
Wer heute Gendern ablehnt, weil es „gegen die Natur der Sprache“ sei, könnte von Goethe, Gottsched und Lessing lernen. Diese Autoren hatten keine Angst, Formen zu erproben, die damals ungewohnt waren. Sie sahen Sprache als lebendiges Werkzeug, das sich den Bedürfnissen der Gesellschaft anpassen muss.
Vielleicht ist das die eigentliche Lehre aus der Geschichte: Sprache ist nie statisch. Sie spiegelt Machtverhältnisse, soziale Rollen und kulturelle Werte wider – und sie verändert sich, wenn diese Werte sich wandeln. Gendergerechte Sprache ist daher nicht nur eine Mode, sondern Teil einer langen Tradition der sprachlichen Selbstreflexion.
„Sprache wandelt sich mit den Menschen, die sie sprechen.“ – frei nach einem alten Sprachforscher-Motto